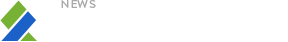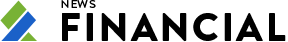Peter Bichsel war bekannt für seine Kurzprosa und sein politisches Engagement. Er beschäftigte sich aber auch intensiv mit dem Thema Religion. Die wichtigsten Aussagen des Schriftstellers zum Christentum und zur Kirche.
Peter Bichsel ist am Samstag, 15. März im Kreis seiner Familie gestorben. Kommende Woche wäre er 90 Jahre alt geworden. Bichsel, der in Bellach bei Solothurn lebte, gehörte zu den bedeutendsten Schriftstellern der Schweiz. Bekannt sind insbesondere seine Kolumnen und Kurzgeschichten. Berühmt wurde er mit dem im Jahr 1964 veröffentlichten Band «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen». Bichsel arbeitete erst als Primarlehrer und ab 1973 als vollberuflicher Autor.
Bichsel äusserte sich in der Öffentlichkeit immer wieder politisch. Er bezeichnete sich als Sozialist, war zeitweise Mitglied der SP sowie Berater von Bundesrat Willi Ritschard. Weniger bekannt ist, dass sich Bichsel auch intensiv mit dem Thema Religion auseinander setzte. Bichsel schrieb zahlreiche Kolumnen zum Thema, hielt Reden und sogar einige Predigten. Der Theologe Andreas Mauz hat im Jahr 2009 Bichsels wichtigste Schriften dazu im Band «Über Gott und die Welt» herausgegeben.
Sein Verhältnis zu Gott
Peter Bichsel wuchs in einem moderat christlichen Haushalt auf. Vor allem der Vater, der in einer pietistischen Freikirche grossgeworden war, ging sonntags regelmässig in die Kirche. Es wurde aber am Familientisch nicht gebetet und über den Glauben wurde nicht gesprochen. Peter Bichsel war bis 13 ein begeisterter Sonntagsschüler, dann selbst Sonntagsschullehrer. In dieser Zeit liebäugelte er mit einer Konversion zum Katholizismus und hatte gar zum Ziel, Missionar zu werden. Es gab Sonntage, da besuchte er um neun Uhr die katholische Messe, um dann um zehn Uhr in der reformierten Kirche Sonntagsschule zu halten.
Bichsel ging im Gegensatz zu seinen Eltern sehr offen mit seinem Glauben um und damit auch auf die Strasse. So skandierte er beispielsweise als Mitglied des «Jünglingsbundes» des Blauen Kreuzes alkoholfeindliche Slogans vor Solothurner Restaurants. In späteren Schriften erklärte Bichsel dieses Verhalten als eine Form der Emanzipation von seinen Eltern: «Ich hatte einen Dreh gefunden, gegen meine Eltern zu rebellieren, ohne dass sie viel dagegen haben konnten. Ich tat ja nichts Schlechtes im religiösen Sinne, ich verstiess nur gegen ihren Grundsatz der Diskretion.» Diese Rebellion galt aber auch der Gesellschaft an sich: «Ich war Mitglied einer etwas belächelten Kirche, und es bereitete mir schelmisches Vergnügen, dass mir diese Kirche niemand verbieten konnte, weil die verlogene Mehrheit von sich behauptete, sie sei christlich und kirchlich und anständig.»
Noch in jungen Jahren wendete sich Bichsel wieder von der Kirche ab. «Ich ersetzte meine Frömmigkeit durch Interesse», schrieb er in seinem Essay «Abschied von der Kirche». Er interessierte sich für Theologie und Philosophie, las Kierkegaard und Barth. Ganz schüttelte er den Glauben aber nie ab, was sich etwa bei einer Studienreise nach Bali 1978 zeigte. Darüber schrieb er: «Die jahrelange religiöse Abstinenz meldete Entzugserscheinungen an. Ich musste abreisen, weil ich befürchtete, Hindu zu werden, und das wollte ich nicht.»
«Ich muss ein religiöser Mensch sein, das habe ich zu akzeptieren, damit habe ich zu leben», schrieb Bichsel als eine Art Fazit. Sein ambivalentes Verhältnis zum Glauben brachte er in späteren Jahren mit unterschiedlichen Worten zum Ausdruck. Einmal sagte er: «Ich glaube an Gott, aber ich weiss, dass es ihn nicht gibt.» Bei anderer Gelegenheit erklärte er: «Ich glaube nicht an Gott, aber ich brauche ihn.» In einem seiner letzten Interviews formulierte er es so: «Ich liebe Gott, aber er liebt mich nicht, weil es ihn nicht gibt.»
Bichsel war zeitlebens Mitglied der reformierten Kirche, auch wenn er der Kirche «nur noch aus sentimentalen, besser gesagt, aus biografischen Gründen» angehörte, wie er einmal erklärte.
Seine Predigten
Peter Bichsel hielt hin und wieder Predigten. Darin sprach er häufig über politische Themen wie die Armee, Armut und Reichtum oder Frauenrechte. Dazu zitierte und reflektierte er konkrete Bibelstellen.
Zur Geschichte von Adam und Eva etwa sagte er: «Ich bin der Eva zutiefst dankbar dafür, dass sie mich mit ihrem freien Entscheid für den Apfel in dieses Leben hineingeboren hat. Es ist mir – Entschuldigung – mehr wert als ein ewiges Leben im Paradies.» Denn: «Ein Leben ohne Dilemma ist kein Leben.» Er meinte damit die Möglichkeit, «dagegen denken zu können.» Genauso, wie es Jesus getan habe. Der Preis dafür sei eben, dass wir sterblich sind.
Im Gespräch mit Dorothee Sölle
Von zentraler Bedeutung für Bichsels Verständnis des Christseins waren die Texte von Dorothee Sölle (1929-2003). Vor allem ein Satz der feministischen Theologin hatte es Bichsel angetan: «Christ sein bedeutet das Recht, ein Anderer zu werden.» Dies sei «der Satz, der mich in meinem Leben am tiefsten betroffen gemacht hat», schrieb Bichsel einmal. Er interpretierte ihn so: «Ich bin nicht nur lieb und opportun, ich bin auch selbst jemand. Ich bin ein anderer.»
Im Jahr 1989 trafen sich Bichsel und Sölle in Zürich zum Gespräch. Sölle erklärt dabei ihren bei Bichsel so beliebten Satz mit den Worten: «Wir müssen annehmen, glauben, denken, hoffen, dass wir alle, an jedem Tag und zu jeder Stunde, fähig sind, umzukehren und anders zu werden.» Denn: «Angesichts des kollektiven Selbstmords, den wir zu begehen in der Lage sind und womit wir fortfahren, ist es wirklich nicht zu verstehen, dass die Leute so weitermachen wollen wie bisher.»
Bichsel gibt dem Gespräch darauf eine politische Richtung. «Ich glaube, wenn es so ist, dass Christsein das Recht, ein Anderer zu werden, vielleicht die Pflicht, sich zu bemühen, anders zu werden, beinhaltet, dann sind wir Schweizer (…) nicht sehr geeignet zu Christen.» Schweizer wollten, dass alles so bleibe, wie es ist. Als Beispiel nennt er den Reichtum, den wir Schweizer – Bichsel bezog sich selbst explizit mit ein – trotz bestehender Armut nicht abgeben wollten. «Reich sein ist eine Aggression, reich sein ist Kriegsführung – ich glaube, damit wäre Jesus wohl einverstanden, mit dieser Interpretation.»
Ausserdem würden Schweizer das Christsein häufig mit öffentlicher Anständigkeit verwechseln. Er kenne einen, der seine Steuern immer zu früh bezahle, weil er denke, es sei eine Sünde, sie zu spät zu bezahlen. Sölle erwidert darauf: «Mit dem armen Mann aus Nazareth loszuziehen bedeutet nicht nur, an die eigene Sünde zu glauben, sondern tatsächlich an die Möglichkeit der Befreiung. Auch wir (…) können frei werden. Es gibt die Freiheit.»
Bichsel dagegen mimt die Rolle des Pessimisten. Er habe keine Hoffnung. Die Optimisten hätten die Welt zerstört. «Diesen Optimismus – ich glaube, den gilt’s zu bekämpfen. Wenn es eine kleine Hoffnung gibt, dann ist es die Solidarität der Traurigen.» Sölle entgegnet mit der in der Bibel geäusserten Form der Hoffnung wider alle Hoffnung. «Die sozusagen statistisch ableitbare Hoffnung, was du jetzt Optimismus nennst, das hat mit Hoffnung als einem existenziellen Akt, in dem ich jetzt – wo ich aus der Verzweiflung einen Schritt herausgehe und etwas sehe vor mir, was anders ist und mich befreit – das hat damit gar nichts zu tun.» Die Bibel sei kein optimistisches Buch. Sie erzähle in einer Sprache des Wunders und nicht der Normalität, «dass erstaunlicherweise unter sehr vielen Blinden hin und wieder Menschen die Augen aufgetan wurden.»
Über Kirche und Politik
Bichsels Essay «Christentum und Politik» aus dem Jahr 1970 ist ein Plädoyer für ein politisches Handeln von Christen. Der Text umfasst drei Thesen. Erstens: «Es gibt keine christliche Politik.» Denn volkstümlich sei «christlich» ein rein ethisch-moralischer Begriff. Christen könnten Ethik und Moral aber nicht für sich allein beanspruchen. «Nicht Ethik und Moral unterscheiden sie von Nichtchristen, sondern ausschliesslich ihr Bekenntnis zu Christus.»
Zweitens: «Es gibt kein unpolitisches Christentum.» Das Christentum habe sich seit jeher politisch verhalten müssen, um seine Präsenz in dieser Welt zu bekommen. Jesus habe die Welt verändern wollen und habe sie zu einem Teil auch verändert. Und was Konsequenzen hat für unsere Welt, ist politisch. Der Kirche müsse bewusst sein, dass sie sich nur politisch verhalten könne und dass «ihre Haltung immer politische Konsequenzen hat.»
Das Christentum habe bis heute seine politische Sprengkraft bewahrt, schreibt Bichsel. Ein Grund dafür sei wohl, dass die christliche Revolution nie stattgefunden habe. «Man hat das Christentum, als es sich nicht mehr aufhalten liess, integriert. Der Staat nannte sich nun christlich.» Dass das Christentum auf Moral und Ethik reduziert wurde, kam dem Staat entgegen. «Der Christ wird dann einfach einer, der sich anständig verhält, und der Staat kann dem Christen jede Freiheit geben, er behält sich nur vor, die Anständigkeit zu definieren. Damit erhält die Staatstreue eine Priorität vor der Treue zu Gott, oder sie wird scheinbar dasselbe. Das Christentum wurde damit zum konservativen Element in der Politik.»
Dritte These: «Es gibt eine Verpflichtung des Christen zur Politik.» Die Sympathie von Christus habe den Armen und Unterdrückten gegolten. «Ihnen hat deshalb auch unsere Sympathie zu gelten.» Das wiederum hiesse, dass wir verpflichtet seien, nichts ungenützt zu lassen, was ihnen helfen könnte. Jedoch werde das mosaische «Liebe Deinen Nächsten» von Christen immer wieder als rein individueller Auftrag verstanden. «Also so, dass jeder Einzelne nett zu den Armen sein muss». Bichsel entgegnet: «Massnahmen gegen Armut und Unterdrückung können wir gemeinsam zu einem Erfolg bringen, weil sie nicht nur eine Angelegenheit der persönlichen Barmherzigkeit sind, sondern letztlich eine Organisationsfrage.»
Seine Kritik an der Kirche
Peter Bichsel hat die Institution Kirche immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihre politische Stimme nicht wahrnehme. Im Referat «Abschied von einer geliebten Kirche» bezeichnet er sie als «halbstaatliche Anständigkeitsinsitution», die wohl «schon sehr bald in ihre Verfassung den schönen Vereinsstatutensatz aufnimmt: politisch und konfessionell neutral.»
Die Kirche glaube dem Staat und seinen Institutionen blind, dass sie christlich seien. Darum habe die Kirche für ihn den Wert als Alternative verloren. Als Schlüsselerlebnisse schildert er Begegnungen mit Feldpredigern in der Armee, wo Bichsel als Sanitäter tätig war. «Die Vorstellung, ein höherer Offizier tröstet mich als Sterbenden im Lazarett, hat für mich etwas sehr Grauenhaftes», schreibt er. Im Gespräch mit der Theologin Dorothee Sölle wurde er diesbezüglich noch deutlicher: «Ein bekennender Christ darf keine Waffe führen. Und zwar gibt es hier keine Ausnahme. Nicht die geringste Ausnahme. Es gibt auch die Ausnahme nicht, dass ich, wenn ich geschlagen werde, als Christ zurückschlagen darf.» Das stehe im Widerspruch dazu, dass es für die Führenden der Kirche selbstverständlich ist, dass die Schweiz eine eigene Armee hat. «Für sie entsteht daraus nicht das geringste Dilemma.»
Fast schon mit Schadenfreude wiederholte Bichsel in seinen Kolumnen und in Gesprächen beinahe mantramässig den Satz: «Der Kirche wird es nicht gelingen, ihren Gründer über Bord zu werfen.» Anders als etwa politische Parteien, die sich kurzerhand neu erfinden können, sei die Kirche auf immer und ewig an Christus gebunden. «Das macht sie spannend und interessant.»
Peter Bichsel: Über Gott und die Welt. Texte zur Religion. Herausgegeben von Andreas Mauz. Suhrkamp, 2009.