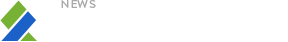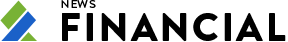Nicht nur die kürzlich verurteilte Lara Warner setzte sich über die Regeln hinweg. Das war in der CS ein Kultur-Problem mit verheerenden Folgen. Die Finma-Chefin fordert neue Gesetze.
Letzten Mittwoch platze eine Bombe: Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) verurteilte Lara Warner mit Verfügung vom 7. März dieses Jahres zu einer Busse von 100’000 Franken. Damit wurde erstmals eine der obersten Führungspersonen der Credit Suisse von den Behörden persönlich zur Rechenschaft gezogen für Verfehlungen in einem der zahlreichen Finanzskandale. Getroffen hat es die ehemalige Risiko- und Compliance-Chefin Lara Warner, die direkt Bankchef Tidjane Thiam unterstand.
Der Grund für die Verurteilung: eine fehlende Geldwäscherei-Verdachtsmeldung im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal Moçambique. CS-Angestellte aus London verhalfen dem bettelarmen Land im Süden Afrikas zu Krediten in der Höhe von 2 Milliarden Franken und kassierten zusammen mit Regierungsbeamten Dutzende Millionen Franken Schmiergeld, das sie teilweise bei der CS in Zürich deponierten.
Warner kam erst 2016 in ihre Position. Begonnen hatte die CS mit ihren Moçambique-Krediten aber schon zwei Jahre früher. Wer war verantwortlich, dass die Kredite bewilligt und im Jahr 2016 an amerikanische Anleger weiterverkauft wurden? Laut Finma kein Geringerer als Gaël de Boissard, damals CEO der CS UK sowie Co-Chef des Investmentbankings. Er war auch Mitglied der Geschäftsleitung der CS-Gruppe.
De Boissard war ab März 2013 in die Moçambique-Kreditgeschäfte involviert und hatte diese, trotz Warnungen des Ethik-Komitees, einem Nein seines Vorgängers und haarsträubenden Erkenntnissen eines extern in Auftrag gegebenen Berichts bewilligt. Dieser Bericht beschrieb den libanesischen Vermittler des Geschäfts als «Meister des Schmiergelds». Auch der damalige Group Credit Risk Officer («CRO») Tobias Guldimann und sein Nachfolger Joachim Oechslin waren über die Bedenken informiert, ohne dass die Feststellungen zu Massnahmen durch die CS-Gruppe führten.
Neben Lara Warner waren ab Anfang März 2016 noch andere über verschiedene Warnungen und «red flags» informiert. Das waren neben Warner Chefjurist Romeo Cerutti, CEO Tidjane Thiam sowie der Verwaltungsratspräsident der CS Group AG, Urs Rohner. Trotzdem stritten sie über Jahre jede Verantwortung ab.
Geldwäschereinorm war eine Folge des Chiasso-Skandals
Dass es in der Schweiz überhaupt eine Geldwäschereinorm gibt, geht auf den CS-Chiasso-Skandal von 1977 zurück. Damals kam aus, dass die CS massenhaft italienisches Fluchtgeld angenommen hatte, das teilweise aus mafiösen Quellen stammte. Danach schlossen die Banken in der Schweiz die sogenannte Sorgfaltsvereinbarung ab. Kern der Vereinbarung war, dass die Banken wissen mussten, von wem das Geld stammt, das sie verwalten.
Von den Bankern wurde diese Norm immer als lästig und bürokratisch empfunden. Darum kam es immer wieder zu Skandalen. In den 90er-Jahren musste die CS sogar Zeitungsinserate schalten, in denen sie ausführte, sie würde die Geldwäscherei bekämpfen.
Der langjährige Verwaltungsratspräsident und frühere Chefjurist Urs Rohner hat, zusammen mit seinem Nachfolger Romeo Cerutti, die Kultur der Bank während 17 Jahren wesentlich geprägt. Während dieser Zeit gab es extrem viele Rechtsfälle und Skandale. Immer wieder stand die Nichteinhaltung der Geldwäschereiserichtlinien im Vordergrund.
Die Finma schrieb 2021 Rohners Nachfolger folgende Zeilen: «Noch nie in der Geschichte der Finma sind bei einem grossen Finanzunternehmen gleichzeitig so viele Sachverhalte aufgedeckt worden, die Durchsetzungsverfahren und dringende Sanierungsmassnahmen erforderlich machten. Dies ist nicht nur auf die jüngsten Vorfälle beschränkt. Von allen grossen Finanzunternehmen in der Schweiz hat die CSG mit acht Finma-Enforcementverfahren und diversen zusätzlichen Verweisen allein in den letzten vier Jahren die deutlich schlechteste Erfolgsbilanz in Bezug auf regulatorische Fragen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine schlechte Erfolgsbilanz bei der Sanierung und eine Kultur der Überoptimierung gegenüber regulatorischen Auflagen gezeigt.»
Riesige Verluste wegen schlampiger Kontrollen
Diese Einstellung führte nicht nur zu einem Imageproblem, die CS verlor auch viel Geld, in den letzten 15 Jahren waren es über 22 Milliarden Franken, weil sie mit Leuten zusammenarbeitete, die moralisch zweifelhaft waren. Für jeden der in der Tabelle aufgeführten Fälle gab es eine Untersuchung der Finma. Ihnen allen war gemeinsam, dass das interne Kontrollsystem nicht funktionierte. Bei den grossen Fällen, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen sorgten – Iwanischwili, Archegos, Greensill und Moçambique –, stellte sich heraus, dass die Geldwäschereivorschriften nicht eingehalten und die Due Diligence, also die Firmenprüfung, nicht korrekt durchgeführt worden war.https://datawrapper.dwcdn.net/pHsch/5/
Nur so konnte es sein, dass die CS mit einem obskuren georgischen Oligarchen, einem kriminellen Hedgefonds-Manager, einem windigen Versicherungsverkäufer und einem libanesischen «Meister der Korruption» überhaupt anfing, Geschäfte zu machen. Dass die CS im Fall von Moçambique ein ganzes Volk in Armut stürzte, gilt als moralisch hoch verwerflich. Hätten die Verantwortlichen die Reglemente befolgt, wäre das nicht passiert. Bei sämtlichen Fällen hat es interne Warnungen gegeben – aber es setzte sich regelmässig das «Business» durch, also die Händler und Verkäufer an der Front, gedeckt von ihren Vorgesetzten.
Lehren aus der Vergangenheit wurden keine gezogen. Die Anwaltskanzlei Paul, Weiss, die den Fall Archegos im Auftrag des Verwaltungsrats der CS untersuchte, riet der CS ganz einfach Folgendes: «Install a culture of accountability, compliance, and respect for controls.»
«Die Finma hat es verpasst, sich Respekt zu verschaffen»
Um die Frage zu prüfen, ob die Finanzmarktaufsicht (Finma) sich gegenüber der CS genügend Respekt verschafft hatte, holte sich die parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) Rat bei den spezialisierten Rechtsanwälten Albrecht Langhart und Matthias Hirschle. Sie zeichnen von der Finma das wenig schmeichelhafte Bild einer Aufsichtsbehörde, die es verpasst hat, sich «gebührenden Respekt zu verschaffen». Dazu nennen sie einige Beispiele: «Im September 2013 musste die Finma im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle zur Zusammenarbeit der CS mit externen Vermögensverwaltern eine ‹Vereitelung von Aufsichtshandlungen› rügen.»
Im November 2014 stellte die Finma im Zusammenhang mit der Vorabklärung zum Devisenhandel weiter eine «inakzeptabel mangelhafte Kooperation» der Bank fest, ebenso in einem Fall 2017. «Die Finma liess es zu, dass die CS zur Auffassung gelangen konnte, dass eine unvollständige oder nicht fristgerechte Umsetzung einer Verfügung der Finma folgenlos bleiben würde, und nahm damit in Kauf, dass der Respekt von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Management der CS gegenüber der Finma leiden könnte.» Das Fazit der Untersuchung: «Die Finma hätte erkennen müssen, […] dass der Verwaltungsrat entweder nicht willens oder nicht fähig war, für eine angemessene Organisation der Bank zu sorgen, wofür er aber als dauernd einzuhaltende Bewilligungsvoraussetzung verantwortlich gewesen wäre.»
Um zu vergleichen, wie die Finma in anderen Fällen vorgegangen ist, schauten sich Langhart und Hirschle das Vorgehen im Fall Pierin Vincenz im Skandal rund um die Raiffeisenbank an, dem zweiten Bankenskandal, der die Schweiz in den letzten Jahren in Atem hielt. In diesem Fall zwang die Finma die Raiffeisen, den Verwaltungsrat auszuwechseln.
Gemäss Langhart und Hirschle hätte das auch bei der CS die Konsequenz sein müssen: «Obwohl der Verwaltungsrat der CS nicht nur dafür verantwortlich war, dass die Organisation und Ausgestaltung des GwG-Abwehrdispositivs sowie die Verwaltungsorganisation und das Risikomanagement über Jahre hinweg systematische und schwerwiegende Mängel aufwiesen, sondern auch dafür, dass die durch die Finma angeordnete Behebung auch danach weder vollständig noch innert Frist umgesetzt wurde», ordnete die Finma keine personellen Konsequenzen im Verwaltungsrat an. «Eine negative Gewährsprognose hätte unseres Erachtens also nicht nur dem Verwaltungsrat der Raiffeisen gestellt, sondern bei der CS im Rahmen eines Enforcementverfahrens geprüft werden müssen.»
Dann wäre die CS vielleicht nicht untergegangen, aber so konnte sie trotz aller Skandale weiterfahren, bis ihr das Geld ausging. Die Finma wollte keine Stellung nehmen.
Er