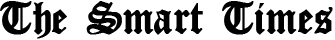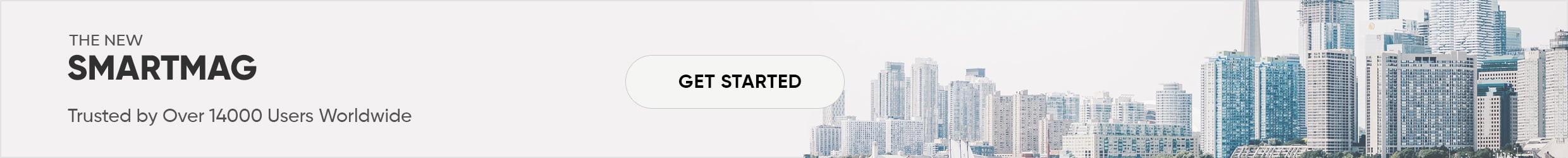Peking würde einen europäisch-chinesischen Schulterschluss willkommen heissen. Aber die deutsche Politik reagiert sehr verhalten.
Dreieinhalb Jahre war die China-Politik der Ampel-Regierung vor allem von Warnungen vor einem systemischen Gegner und zu grossen Abhängigkeiten geprägt. Das Verhältnis zwischen Peking und Berlin kühlte spürbar ab. Doch seit US-Präsident Donald Trump die Weltwirtschaft mit seiner wechselhaften Zollpolitik ins Chaos stürzt, wittert die Führung in Peking eine Chance, Deutschland und Europa wieder enger an sich zu binden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus mehreren Quellen hat die chinesische Regierung bei etlichen europäischen Regierungen hinter den Kulissen angefragt, ob man nicht gemeinsame Erklärungen zu Multilateralismus und Freihandel veröffentlichen könnte.
Während im China-Geschäft tätige Unternehmen auf eine Lockerung der bisherigen Politik dringen, ist die Reaktion der deutschen Politik parteiübergreifend sehr verhalten. «Was vorher falsch war – eine zu grosse Abhängigkeit von China -, wird auch durch Trumps verfehlte Zollpolitik nicht richtig», sagt der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen der Nachrichtenagentur Reuters. «Vorsicht ist angebracht», betont auch der aussenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid. «Auch Trump macht aus dem autoritären China keinen Partner Europas», mahnt Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner.
Unternehmen wollen Lockerungen
Allerdings macht die Wirtschaft Druck. «Deutsche Unternehmen in China erwarten mehr Rückhalt von der Bundesregierung und eine ausgewogenere Beziehung, die China auch als Partner sieht», sagt Oliver Oehms, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Nordchina, zu Reuters. «Denn die derzeitige Wahrnehmung Chinas in Deutschland stellt für die Unternehmen eine erhebliche Hürde dar», fügt er hinzu. Auch die «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» berichtet, dass mehrere Dutzend deutsche Unternehmen in einem Papier an den designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU) forderten, China weniger als Gegner, sondern mehr als Partner anzusehen.
Dahinter steckt auch die Analyse, dass deutsche Konzerne in China an Boden verloren haben und schon wegen der betont kritischen China-Politik Deutschlands nicht mehr als bevorzugte Partner angesehen werden. Die deutschen Exporte nach China brachen im Januar und Februar laut Statistischem Bundesamt um 18,6 Prozent ein – während die Importe um 15 Prozent stiegen.
Vorsichtiger äussert sich der Maschinenbauverband VDMA. «Insbesondere die erratischen Zollankündigungen aus dem Weissen Haus sorgen derzeit dafür, dass die meisten Marktteilnehmer abwarten, ob sich irgendwann ein klareres Bild ergibt, auf dem man planen kann», sagt Ulrich Ackermann, Leiter Aussenwirtschaft des VDMA. «Das gilt in der Konsequenz auch für den Umgang mit China.»
Probleme mit China bleiben
«Die erste und wichtigste Auswirkung der Trumpschen Zollpolitik ist die Umleitung von Exporten aus China Richtung EU», kritisiert SPD-Politiker Schmid. «Die chinesische Wirtschaft ist geprägt von Überkapazitäten in der Güterproduktion und der damit einhergehenden Exportschwemme.» Präsident Xi wolle daran offenkundig kurzfristig nichts ändern und versuche vielmehr, mittels seiner aktuellen Tour durch Südostasien die dortigen Volkswirtschaften noch enger an China zu binden und über Re-Exporte aus diesen Ländern die amerikanischen Strafzölle zu umgehen. CDU-Aussenpolitiker Röttgen mahnt, dass es «geradezu dumm» von der EU wäre, im Zollstreit zwischen den USA und China Partei zu ergreifen.
Mit Blick auf die chinesische Offerte an europäische Regierungen sagt auch ein EU-Diplomat zu Reuters: «Die Chinesen spielen sich jetzt als Heilige des Welthandels auf. Aber sie sprechen weder die Überkapazitäten, die eigenen Subventionen oder den unfairen Wettbewerb an.» Bei allem eigenen Ärger über die erratische US-Zollpolitik werden es schon deshalb nicht zu dem von Peking erhofften europäisch-chinesischen Schulterschluss kommen. China weigere sich bis heute, dem WTO-Abkommen über Subventionen beizutreten.
Risiko Krieg um Taiwan
Es gibt zudem zwei politische Gründe für die Vorsicht auch in Deutschland. «Putins Angriffskrieg wird durch starke chinesische Unterstützung weiter am Laufen gehalten, was europäische Kerninteressen verletzt», kritisierte Grünen-Chefin Brantner. Dazu komme das Risiko, dass China irgendwann seine Drohungen wahrmacht und Taiwan angreift, um sich die als abtrünnigen Landesteil betrachtete Insel militärisch einzuverleiben. Gerade erst hat das chinesische Militär gross angelegte Manöver veranstaltet, was in dem demokratisch organisierten Taiwan als Drohgebärde angesehen wird. Bei einem Krieg würden aber die Handelsströme mit China ohnehin zusammenbrechen, warnt ein Regierungsvertreter.
Dennoch verändert sich Verhältnis EU-China
Allerdings: Die politische Ablehnung bedeutet nicht, dass die US-Zollpolitik nicht doch etwas im europäisch-chinesischen Verhältnis ändert – weil Peking unter Druck steht. Grünen-Chefin Brantner etwa sieht die Chance, nun von Peking Zugeständnisse bei einer ganzen Reihe von Kritikpunkten zu erhalten. «Denn China möchte den Zugang zu Europa nicht verlieren», sagte sie. Chinas Führung könne am Beispiel der Elektromobilität zeigen, dass sie wirklich bereit für fairen Handel sei. Tatsächlich bewegt sich etwas in den Verhandlungen zwischen der EU und China über E-Autos, um einen Ersatz für die verhängten Strafzölle zu erreichen. So könnte es eine Vereinbarung über Mindestpreise für in China hergestellte Elektrofahrzeuge geben, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag. Diese würden anstelle der von der EU 2024 eingeführten Ausgleichszölle gelten,
Brantner fordert, China zudem klare Regeln für die Präsenz in der EU aufzustellen: Faire Wettbewerbsbedingungen könnten etwa durch Joint Ventures erreicht werden. Nötig sei zudem, dass chinesische Firmen auf europäische Zulieferer zurückgreifen und hierzulande in technologisches Know-How investieren, etwa in der Batteriezellenentwicklung. China selbst macht für seinen Markt strenge Vorschriften, was ausländische Firmen auf dem chinesischen Markt selbst produziert müssen.